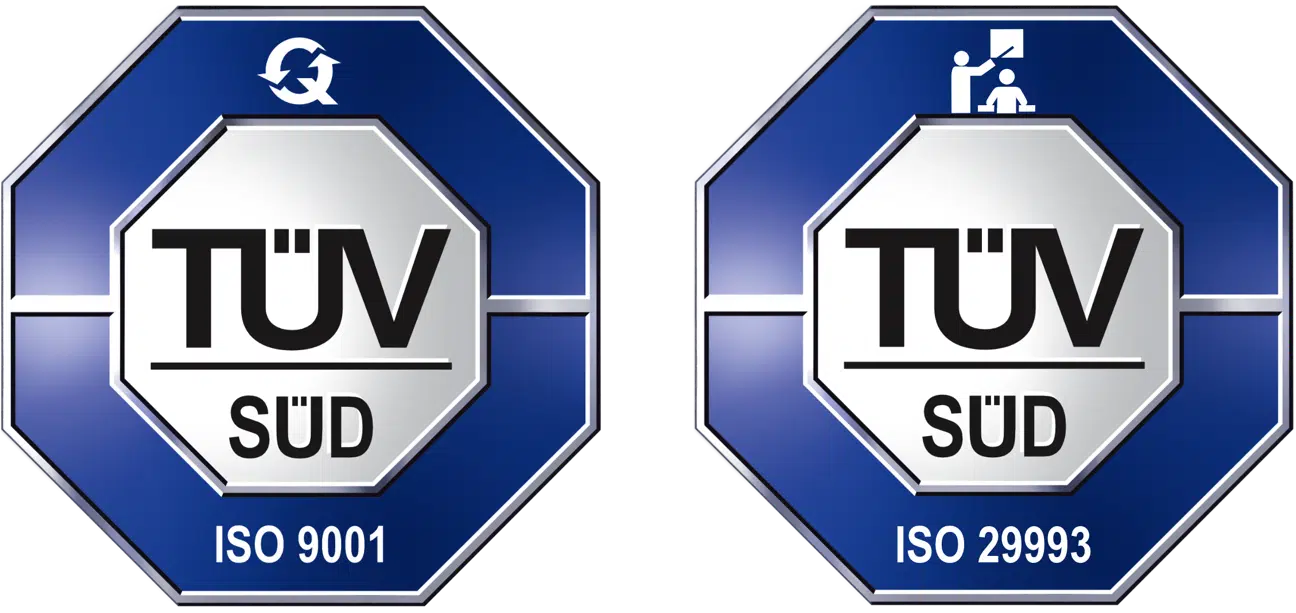Siebzig Meter unter der Capilano Canyon Suspension Bridge in Kanada liegen Felsen und Stromschnellen. Dem jungen Mann auf der wackligen Hängebrücke klopft das Herz. Da kommt eine attraktive Frau auf ihn zu und bittet ihn, einen Fragebogen für ihren Psychologiekurs auszufüllen. Für Rückfragen gibt sie ihm ihre Nummer. Er wird sie anrufen – und das nicht, weil er Fragen hätte, sondern weil er die Dame so attraktiv fand.
Ob die Frau jedoch an einem anderen Ort zu anderer Zeit ähnlich stark auf den jungen Mann gewirkt hätte, ist fraglich. Denn die extreme Situation hat den jungen Mann wahrscheinlich verwirrt: Unbewusst hat er den Schluss gezogen, dass sein Herz wegen dieser Frau gerast hat. Und die Brücke dabei völlig vergessen.
Dieses Szenario stammt aus einer Studie von Donald G. Dutton und Arthur Aron von der University of British Columbia in Vancouver. Tatsächlich rief jeder zweite Mann die Frau zurück, wenn sie ihn auf der wackligen Brücke interviewt hatte. Fand das Interview dagegen auf einer Bank oder im Park statt, meldeten sich nur halb so viele Versuchspersonen. Eine mögliche Erklärung für diesen Anflug von Romantik ist eine so genannte Fehlattribution der physiologischen Erregung: Das Gehirn registriert die körperliche Wallung und sucht nach einem plausiblen Grund. Manchmal ordnet es die Aufgeregtheit jedoch der falschen Ursache zu, in diesem Fall der Frau statt der Hängebrücke.
Der Körper beeinflusst das Gehirn
Der Körper beeinflusst das Gehirn auf viele Weisen. “Embodiment”, “Verkörperung”, nennen Kognitionswissenschaftler dieses Phänomen. Sie gehen davon aus, dass der Körper mehr ist als nur Hardware für die Software des Geistes. Der bekannte Neurowissenschaftler António Damásio von der University of Southern California bringt diese Ansicht auf den Punkt: “Der Geist ist nicht nur eine Sache des Gehirns, sondern auch des Körpers” – was sich im Original viel schöner anhört: “The mind is embodied, not just embrained.”

Dahinter steckt die Idee, dass das Denken eng verstrickt ist mit dem, was der Körper empfindet und tut. Man nimmt zum Beispiel an, dass die Wärme eines Heißgetränkes im Gehirn die Vorstellung von emotionaler Wärme auslöst. Zumindest schätzen Menschen eine fremde Person als freundlicher, hilfsbereiter und vertrauenswürdiger ein, wenn sie gerade eine warme Tasse in der Hand halten.
Ein Grund hierfür liegt möglicherweise im modularen Aufbau der Gehirnrinde: Dort gibt es Bereiche, die auf bestimmte Funktionen spezialisiert sind, etwa die Verarbeitung von Sehreizen zur Erkennung von Farben, Bewegungen, Empfindungen, Lauten oder Gerüchen. Untereinander sind sie stark vernetzt. Aktiviert eine Information ein Modul, breitet sich diese Aktivität auch in anderen Gehirnarealen aus, die mit diesem verbunden sind.
Neurowissenschaftler nehmen an, dass das Gehirn abstrakte Konzepte wie emotionale Wärme mit körperlichen Erfahrungen verknüpft, um sie zu verstehen. Wenn eine Mutter ihr Baby im Arm hält, nimmt der Säugling ihre Körperwärme wahr. Diese frühen Erfahrungen bilden vielleicht das Gerüst, an dem Kinder ein komplexes Konzept wie emotionale Wärme erlernen können. Auch Jahre später kann unser Gehirn auf unsere frühen Körperempfindungen zurückgreifen – und wenn wir dann im Büro einen heißen Kaffee in der Hand halten, aktiviert die Wärmeempfindung das damit verknüpfte Konzept und wir nehmen die anwesenden Kollegen als herzlicher wahr. Das spiegelt sich auch auf neuronaler Ebene wider – der Inselcortex ist an der Empfindung von psychischer und physischer Wärme beteiligt.
Reinwaschen des Gewissens
Doch nicht nur, was der Körper berührt, beeinflusst das Denken. Auch eigene Handlungen wirken sich auf die Kognition aus. Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür ist der so genannte “Macbeth-Effekt”, benannt nach Shakespeares gleichnamigem Stück. Dort wäscht sich Lady Macbeth verbissen die Hände, um sich von der Schuld am Tod des schottischen Königs reinzuwaschen. Ganz ähnlich verhielten sich die Teilnehmer einer Studie des Teams um Verhaltenswissenschaftler Chen-Bo Zhong von der University of Toronto: Hatten sich die Probanden an eine eigene unmoralische Tat erinnert und diese beschrieben, wählten sie als Belohnung für ihre Teilnahme eher ein antiseptisches Tuch statt eines Stiftes.
Und anders als bei Lady Macbeth – der alles Waschen nichts hilft und die das Gefühl nicht los wird, dass das Blut des Ermordeten an ihren Händen klebt –, scheint in der Realität der Effekt auf das Gewissen größer zu sein. Das zumindest zeigt ein weiteres Experiment, bei dem die Probanden ebenfalls ein persönliches Vergehen beschreiben sollten. Im Anschluss durfte sich die Hälfte der Teilnehmer die Hände mit einem antiseptischen Tuch reinigen. Danach empfanden sie weniger Schuld- und Schamgefühle sowie geringeren Ekel.
Beim Macbeth-Effekt vermuten Linguisten und Psychologen ebenfalls, dass Menschen das komplexe Konzept der moralischen Reinheit anhand körperlicher Erfahrungen erlernt haben. In vielen Sprachen finden sich dafür Hinweise: Im Deutschen hat man ein “reines Gewissen” oder “eine weiße Weste”, im Englischen beschreiben “clean” und “pure” körperliche und moralische Sauberkeit und im Chinesischen bezeichnet der Ausdruck “dreckige Hände” einen Dieb. Auch bildgebende Verfahren zeigen diesen Zusammenhang. Wenn wir uns vor verdreckten Toiletten ekeln, verziehen wir nicht nur das Gesicht auf die gleiche Weise wie beim Angewidertsein angesichts korrupter Manager – wir aktivieren sogar teilweise überlappende Gehirnregionen, vor allem in Stirn- und Schläfenlappen.
Haltung und Mimik
Auch die eigene Körperhaltung und Mimik beeinflussen unsere Geisteshaltung. “Halt dich gerade, Kind”, mahnt die Großmutter – und hat Recht. Studien deuten darauf hin, dass man sich selbstbewusster fühlt, wenn der Rücken aufrecht gehalten wird. Auch Schauspieler berichten oftmals, dass sie ein Gefühl tatsächlich empfinden, wenn sie es darstellen. Geht es einem nicht gut, kann es zum Beispiel helfen, die Mundwinkel hochzuziehen. Das konnte der Psychologe Fritz Strack von der Universität Würzburg schon 1988 zusammen mit Kollegen in einer Studie zeigen. Die Probanden betrachteten Cartoons und hielten währenddessen einen Stift entweder mit ihren Zähnen, wodurch das Lächeln erleichtert wird, oder mit ihren Lippen, wodurch das Lächeln erschwert wird. Im Anschluss beurteilten sie Cartoons als lustiger, wenn sie den Stift mit den Zähnen gehalten hatten. Dies entspricht der Annahme der Facial-Feedback-Hypothese, nach der der Gesichtsausdruck emotionales Erleben und Verhalten beeinflusst.
Unsere Mimik hilft uns jedoch nicht nur, die eigenen Gefühle zu erkennen, sondern auch die Emotionen anderer. Studien suggerieren, dass Menschen Emotionen auf Fotos von Gesichtern besser identifizieren können, wenn sie den gezeigten Ausdruck nachahmen. Im Gehirn sind dabei ähnliche Areale aktiv, als ob der Betrachter die Emotionen selbst empfinden würde. Psychologen vermuten, dass diese Simulation des Mienenspiels anderer eine wichtige Rolle für Empathie spielt.
Es gibt also viele Hinweise darauf, dass unser Körper dem Gehirn hilft, Komplexes zu begreifen, eigene Gefühle wahrzunehmen und sich in andere hineinzuversetzen.
(Quelle: www.dasgehirn.info, Autor Hanna Drimalla, Wissenschaftlicher Beitrag Dr. Christian Pfeiffer und Prof. Dr. Martin Lotze)